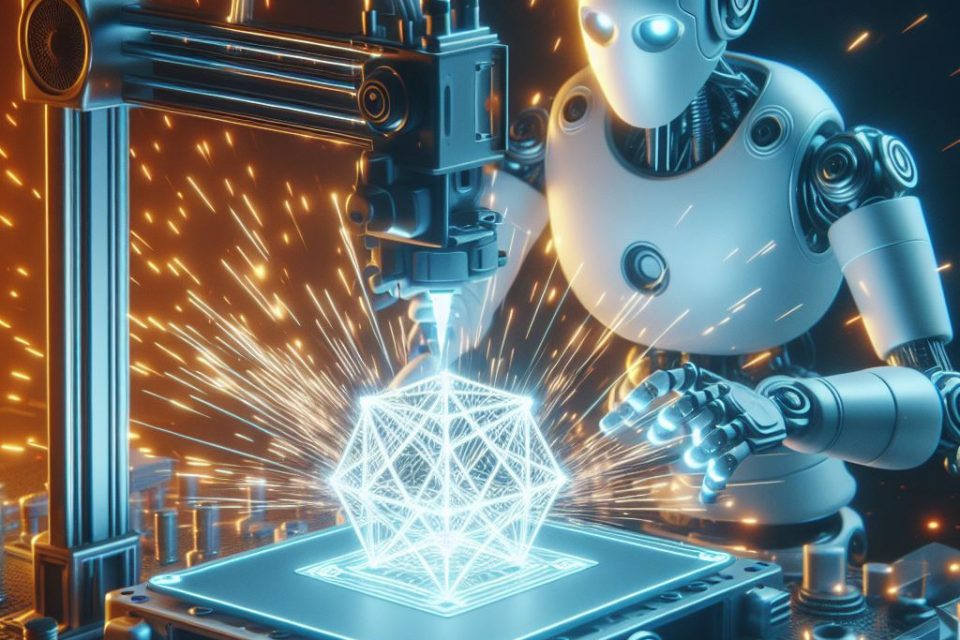2. Wasserstoff-Symposium: Energieträger der Zukunft
24. November 2019
Hafen trifft Festland: letzte Station 2019 in Ludwigsburg
8. Dezember 2019Auf der AutoDigital in Bremen haben Experten die Zukunft der Mobilität diskutiert, über Chancen und Probleme – und über den Geruch von Neuwagen.
Text von Stefan Lakeband, Weser-Kurier vom 5. Dezember 2019
Autofahren spricht die Sinne an. Die Augen schauen auf die Straße, die Ohren horchen auf den Verkehr, die Nase nimmt den Geruch im Innenraum wahr. Der ist, so könnte man aus den Worten von Mercedes-Vorstand Jörg Burzer schließen, ein heikles Thema – je nachdem, auf welchem Teil der Erde man sich befindet. Warum, das erklärte er am Mittwoch, dem 4. Dezember 2019, auf der vierten AutoDigital-Konferenz des WESER-KURIER.
Deutsche lieben den Geruch eines Neuwagens, sagt Burzer. In China sei das anders. „Egal ob BMW, Audi oder Mercedes: Chinesische Kunden mögen diesen Geruch nicht und kritisieren das.“ Sein Unternehmen habe es sich deswegen zur Aufgabe gesetzt, neue Fahrzeuge in der Bundesrepublik mit diesem Geruch auszuliefern, in Asien aber nicht. Burzers Beispiel, es lässt keinen Zweifel: Der Automobilbau ist komplex, und – das wird auf der AutoDigital auch deutlich – die Geruchswünsche von Kunden sind da eher ein kleines Problem für die Hersteller.
„Die Zeit ist eine schwierige“, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) in seinem Grußwort an die rund 130 Gäste. Das spürten nicht nur die Hersteller und Zulieferer, sondern auch deren Mitarbeiter. Die Hansestadt sei da keine Ausnahme. So hatte Bosch erst kürzlich angekündigt, seine Produktion aus Huchting nach Ungarn zu verlagern, Thyssen-Krupp Engineering gab bekannt, 300 Stellen in Bremen abzubauen, und auch im Daimler-Konzern werden Jobs gestrichen, 10.000 insgesamt – die Auswirkungen auf das Werk in Sebaldsbrück sind noch unklar. Strengere CO2-Vorgaben der Politik, hohe Kosten durch den Dieselskandal, Milliardeninvestitionen in Zukunftstechnologien, die Digitalisierung – es ist ein schwieriges Feld, in dem sich die Produzenten bewegen. Dennoch ist Bovenschulte optimistisch: „Ich bin überzeugt, dass die deutschen Anbieter die Zeichen der Zeit erkannt haben“ – wenn vielleicht auch etwas spät.
Wie Mercedes auf diese Herausforderungen reagiert, macht Burzer im Anschluss deutlich. Der Konzern, so sagt der Vorstand, befinde sich in einer Transformation und habe sich gleichzeitig hohe Ziele gesteckt: Bis 2030 soll jeder zweite Mercedes elektrisch angetrieben werden – also entweder als reines E-Auto fahren oder als Hybrid; bis 2022 will der Konzern in Europa CO2-neutral produzieren. Eine der jüngsten Antworten auf die Fragen der Zukunft kommt aus Bremen: Hier wird seit einigen Monaten der EQC gebaut – das erste Elektroauto von Mercedes. „Einen der besten Anläufe, den wir in den letzten zwölf Monaten hatten“, nennt Burzer den Beginn der Produktion. Der EQC wird auf derselben Montagelinie gefertigt wie die anderen Autos im Bremer Werk. Der Grund: Flexibilität. „Wir wissen nicht genau, wie sich der Markt entwickelt“, sagt der Vorstand. Je nach Nachfrage könne man so schnell reagieren, Autos mit den verschiedensten Antriebsarten und unterschiedlichste Modelle bauen.
Diese Flexibilität, die in Bremen bereits praktiziert werde, gibt die Marschrichtung für die Zukunft vor – und für die Factory 56. Sie ist laut Burzer „die Blaupause für die Fabrik der Zukunft“. Der erste Ableger soll in Sindelfingen entstehen. Hier könnten Mitarbeiter unter anderem schneller ihren Arbeitsplatz wechseln, die Positionen seien ergonomisch angepasst. Viele Aspekte aus dem Bremer Werk seien hier eingeflossen.
Der Wandel der Automobilindustrie betrifft aber nicht nur die Hersteller, sondern mindestens genauso sehr die Zulieferer. Einer von ihnen ist Hella mit Hauptsitz in Lippstadt und Ableger in Bremen. Die Zukunft des Konzerns sei mit der der Autobauer verwoben, macht Lennart Hammerström deutlich, Leiter für Operations Engineering bei Hella. „Die Entwicklungszyklen werden kürzer“, sagt er. Zwar gebe es bei den meisten Herstellern einen Modellwechsel nach sieben Jahren, eine Auffrischung häufig aber schon nach 3,5 Jahren. Daher müssten Zulieferer schnell entwickeln können, um dafür neue Produkte anzubieten. „Wir müssen jetzt die strategischen Entscheidungen treffen, die zu unseren Kunden passen“, sagt Hammerström. Dazu gehöre auch, Dinge zu entwickeln, die die Kunden nicht anforderten – aber durchaus gebrauchen könnten. Ein Beispiel sei der Shake-Sensor, der in der Bremer Niederlassung zusammen mit der Uni entwickelt wurde. „Er kann Vibrationen am Fahrzeug erkennen“, sagt Hammerström. Wenn auf dem Parkplatz etwa ein Einkaufswagen gegen die Karosserie rolle, dann speichere das der Bordcomputer. „Das kann für Autoverleiher und Carsharing-Unternehmen interessant sein.“
Neben der Marktentwicklung stehen Unternehmen wie Hella aber auch noch vor anderen Problemen: dem Mangel an Fachkräften. Beschäftigte würden zwar weiterqualifiziert, neue Mitarbeiter zu finden, werde aber immer schwieriger. Das Problem kennt auch Christof Büskens, der als Professor an der Uni Bremen autonomes Fahren erforscht. „In unserem Bereich gibt es eine Arbeitslosenquote von 0,0 Prozent“, sagt er. Dass die Zahl der Ingenieure und Softwareentwickler für den Automobilbau zu gering sei, sieht er nicht als Folge von zu wenig Ausbildungsangeboten. Im Gegenteil: Es gebe einfach nicht genug junge Menschen, die sich dafür interessierten. „Die Begeisterung für Mint-Fächer hat nachgelassen“, sagt der Wissenschaftler. In Kindergärten, Schulen und Familien müsse wieder mehr Wert darauf gelegt werden, dass Kinder sich für Natur- und Ingenieurswissenschaften interessieren.
Auch angesichts der schwierigen Zeiten würden Büskens und Hammerström jungen Leuten nicht davon abraten, sich einen Job in der Automobilbranche zu suchen – kleineren und größeren Krisen zum Trotz. „Je nachdem, wofür man sich interessiert, ist man dort gut aufgehoben“, sagt Hammerström. Für Büskens ist die Vielseitigkeit ein wichtiges Argument. Es würden nicht nur Ingenieure gesucht, sondern ebenso etwa Informatiker und Softwarespezialisten – und wohl auch der ein oder andere Geruchsexperte.
Quelle Foto: Weser Kurier